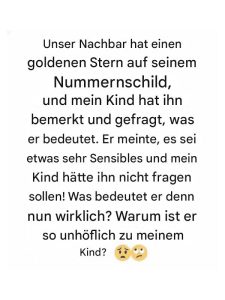Sie zog Leo allein groß. Sie erwähnte seinen Vater nie, und wann immer ich vorsichtig fragte, wandte sie den Blick ab.
„Es ist kompliziert“, sagte sie leise. „Vielleicht erkläre ich es dir eines Tages.“Ich habe nicht weiter nachgehakt. Nora hatte schon genug Schmerz ertragen. Wenn sie bereit war, würde ich ihr zuhören.
Bis dahin tat ich, was Familie eben so tut – ich war da. Ich half beim nächtlichen Füttern und Windelwechseln. Ich brachte Lebensmittel mit, wenn das Geld knapp war. Ich las ihr Gutenachtgeschichten vor, wenn sie schließlich vor Erschöpfung zusammenbrach.
Ich war bei Leos ersten Schritten, seinen ersten Worten, jedem Meilenstein dabei. Nicht als sein Vater, sondern als jemand, der seiner besten Freundin einst versprochen hatte, dass sie niemals allein durchs Leben gehen würde.
Doch Versprechen schützen nicht vor dem Schicksal.
Vor zwölf Jahren, als ich 26 war, klingelte mein Telefon um 23:43 Uhr.
Halb im Schlaf nahm ich den Anruf entgegen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine fremde Person.
„Ist da Oliver? Ich rufe aus dem Krankenhaus an. Ihre Nummer hat mir Noras Nachbarin gegeben. Es tut mir sehr leid, aber es hat einen Unfall gegeben.“
Die Zeit stand still.
Nora war fort. Einfach so. Ein Autounfall auf regennasser Autobahn – vorbei in Sekundenschnelle. Kein Abschied. Keine letzten Worte. Keine Chance, all das zu sagen, wofür man sonst immer Zeit hätte.
Sie hinterließ einen kleinen Jungen von kaum zwei Jahren – einen Jungen, der nicht nur seine Mutter, sondern auch das einzige Leben verloren hatte, das er je gekannt hatte.
Leo hatte keinen Vater in seinem Leben. Keine Großeltern. Keine weitere Familie. Nur mich.
Ich fuhr die ganze Nacht hindurch, um ihn zu erreichen. Ein Nachbar, der Leo sonst immer betreute, während Nora arbeitete, hatte ihn nach dem Notruf ins Krankenhaus gebracht. Als ich das Zimmer betrat und ihn in einem viel zu großen Schlafanzug auf dem Bett sitzen sah, einen abgenutzten Stoffhasen umklammernd, unglaublich klein und verängstigt, zerbrach etwas in mir.
Sobald er mich sah, streckte er die Hände aus und krallte sich mit seinen kleinen Händen in mein Hemd.
„Onkel Ollie… Mama… rein… geht nicht…“
„Ich bin da, Kumpel. Ich lasse dich nicht im Stich“, sagte ich. „Versprochen.“ Und ich meinte jedes Wort.
Später erklärte eine Sozialarbeiterin sorgfältig die verschiedenen Möglichkeiten – vorübergehende Unterbringung in einer Pflegefamilie, gerichtliche Entscheidungen, eventuelle Adoption durch Fremde, falls sich keine Familie finden würde. Ich unterbrach sie, bevor sie ausreden konnte.
„Ich gehöre zu seiner Familie“, sagte ich ohne zu zögern. „Ich nehme ihn auf. Ich werde alles Notwendige tun – Papierkram, Hintergrundüberprüfungen, Hausbesuche, Gerichtsverhandlungen. Er bleibt bei mir.“
Der Prozess dauerte Monate – Gutachten, rechtliche Schritte und der Nachweis, dass ich einem trauernden Kleinkind ein stabiles Zuhause bieten konnte. Mir war egal, wie lange es dauerte oder wie schwierig es war.
Leo war alles, was mir von Nora geblieben war, und ich weigerte mich, ihn so aufwachsen zu lassen, wie wir es getan hatten – allein und ungewollt.
Sechs Monate später wurde die Adoption offiziell. Über Nacht wurde ich Vater. Ich trauerte, war überwältigt und hatte große Angst – aber ich habe die Entscheidung nie bereut.
Die nächsten zwölf Jahre vergingen wie im Flug – Schulmorgen, Pausenbrote, Gutenachtgeschichten und aufgeschürfte Knie. Meine Welt drehte sich nur noch um dieses Kind, das schon so viel verloren hatte.